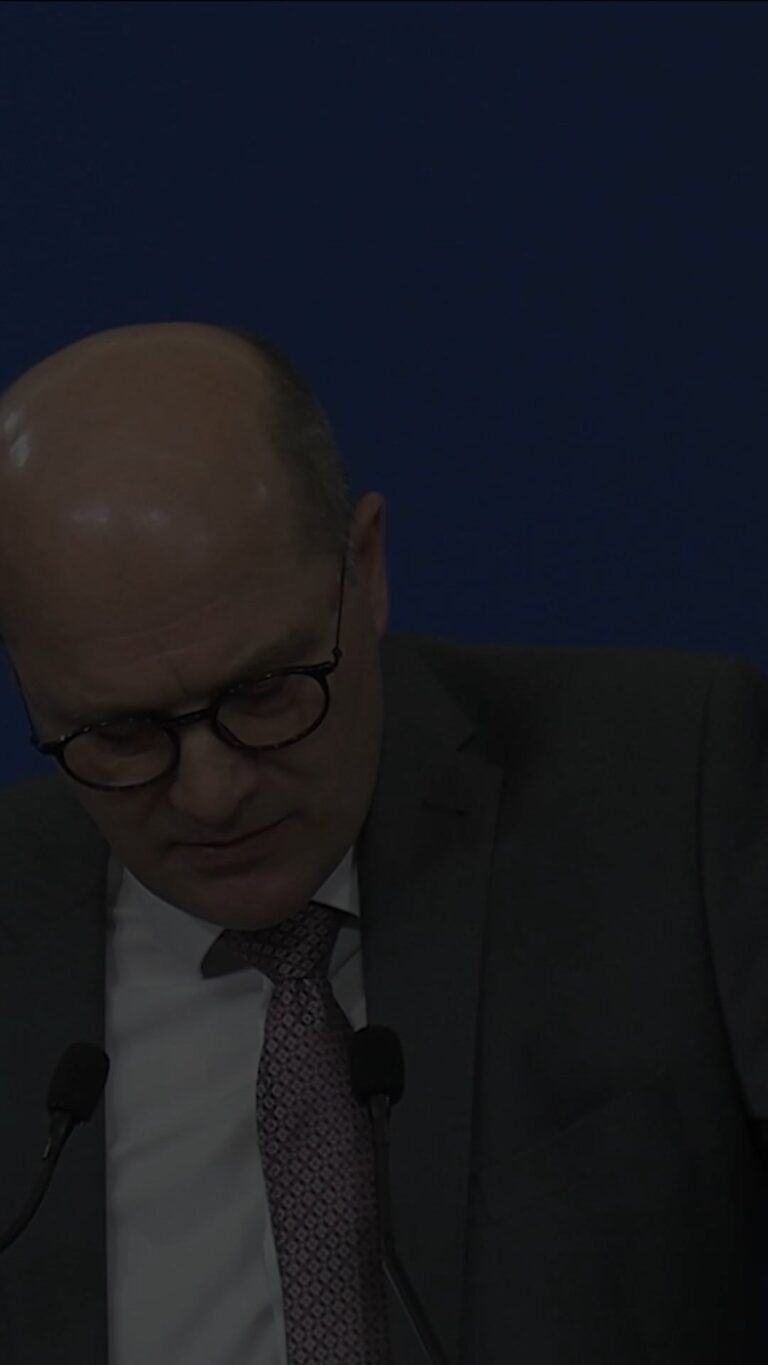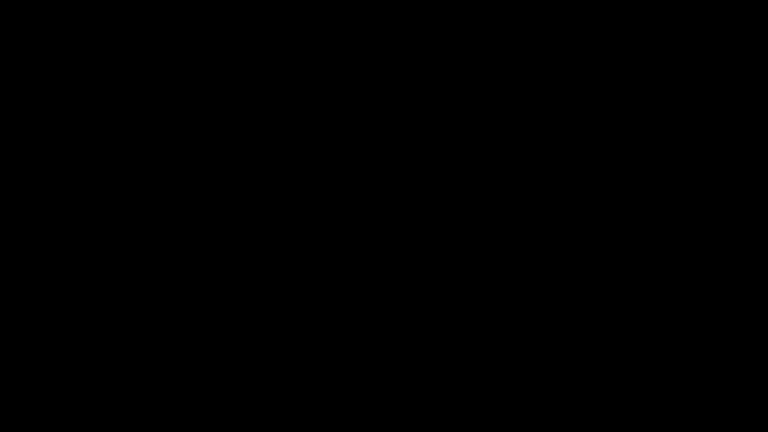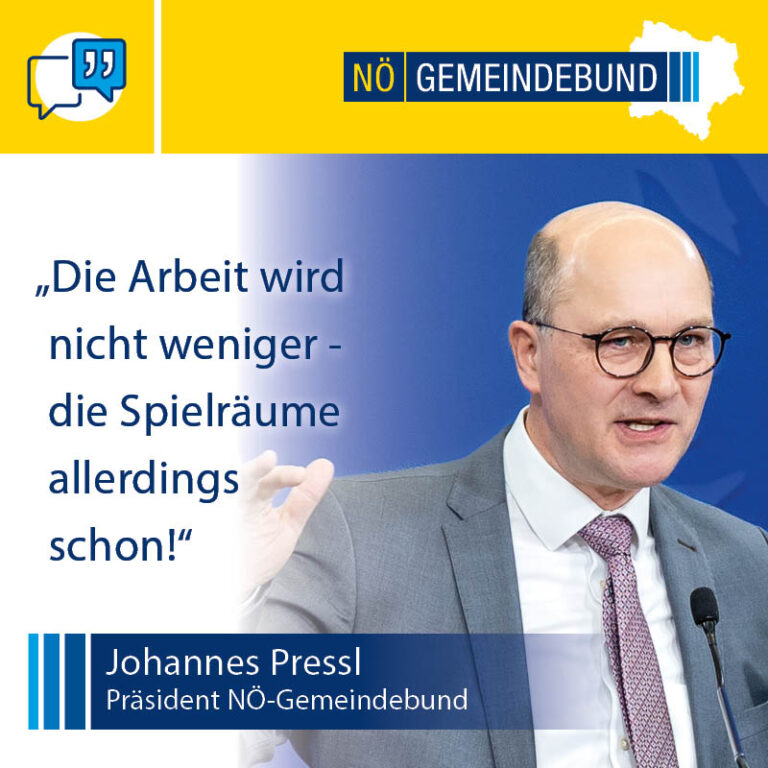Vom explosionsartigen Anstieg der Kosten im Gesundheitswesen sind auch die Aufgaben im Bereich des Rettungsdienstes nicht verschont geblieben. Da Art. 118 Absatz 3 Ziffer 7 B-VG das örtliche „Hilfs- und Rettungswesen“ – als Bestandteil der örtlichen Gesundheitspolizei – den Gemeinden überträgt, stehen diese (neben Ländern und Sozialversicherungsträgern) unter immer stärkerem Druck, die finanziellen Mittel für ein leistungsfähiges und flächendeckendes Rettungswesen aufzubringen.
Gastkommentar: Martin Huber
Die Erbringung der Leistungen, die im Zusammenhang mit dem örtlichen Hilfs- und Rettungswesen stehen (beginnend bei Rettungs- und Krankentransportdiensten bis hin zu Ambulanzdienstleistungen bei größeren Veranstaltungen), erfolgt in fast allen Bundesländern durch landesgesetzlich anerkannte Rettungsorganisationen (Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariterbund, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser-Hospitaldienst-Austria und andere) im Auftrag der Städte und Gemeinden. Abgesehen von den bundesrechtlichen Ausbildungsvorschriften (SanG) ist die gesetzliche Regelung des Rettungswesens Ländersache – beginnend bei der genaueren Definition des Hilfs- und Rettungswesens über die Anerkennung der Rettungsorganisationen, die personelle und sachliche Ausstattung bis hin zur Finanzierung bzw. dem Rettungsbeitrag der Gemeinden.
Versorgungssystem und Ehrenamt
Im Detail weichen die landesgesetzlichen Grundlagen erheblich voneinander ab; dies gilt auch für die Beitragsleistungen der Gemeinden. Die rettungsdienstliche Versorgung in Österreich gilt grundsätzlich als leistungsstark und flächendeckend – vor allem durch ein dichtes Netz an Dienststellen mit mehr als 36.000 Ehrenamtlichen, die gerade im ländlichen Raum das Rettungswesen gemeinsam mit Hauptamtlichen, Zivildienstleistenden und Absolventinnen und Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sicherstellen. Seit den 1970er-Jahren gewährleistet
ein Verbundsystem aus bodengebundener und luftgestützter Notfallversorgung bei schweren Unfällen und Erkrankungen (von sogenannten „kritischen Patienten“) einen auch im internationalen Vergleich hohen Standard in der Notfallmedizin.
Ursachen der Kostensteigerung
Die Ursachen für die Kostensteigerungen im Rettungswesen sind in fast allen Bundesländern ähnlich: eine zunehmend älter werdende Bevölkerung und der damit einhergehende höhere Bedarf an Transporten (vor allem im Hinblick auf geriatrische Erkrankungen), das sinkende Angebot regional niederschwelliger medizinischer Leistungen, die sinkende Zahl an niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und die Einschränkung von Hausbesuchen, die erhöhten Qualitätsstandards im Rettungswesen sowie die abnehmende bzw. stagnierende Zahl an Zivildienern (in einzelnen Regionen auch der Ehrenamtlichen), die durch hauptberufliches Personal ersetzt werden müssen. Trotz bundesweit ähnlicher Herausforderungen bestehen ungewöhnlich hohe Unterschiede bei den Beiträgen, welche die Gemeinden je nach Bundesland für den örtlichen Hilfs- und Rettungsdienst leisten müssen. Die Spanne reicht von 7,52 Euro im Bundesland Salzburg bis zu 24,42 Euro im Burgenland (Stand 2024). Diese Unterschiede sind einerseits den unterschiedlichen Aufteilungsschlüsseln zwischen Ländern und Gemeinden und andererseits dem jeweiligen Finanzbedarf der Einsatzorganisationen geschuldet. Faktoren wie das stationäre und ambulante Gesundheitsversorgungsangebot in der Region, die Siedlungs- und Verkehrsstruktur, die Topographie, Bevölkerungsdichte oder die Tourismusintensität sind dabei nur einige Einflussgrößen. Hinzu kommen die unterschiedlichen Finanz-, Personal- und Organisationsstrukturen der Rettungsdienstträger.
Reformbedarf und Zukunftsperspektiven
Eine schnelle Pauschallösung für die Herausforderungen, vor denen das Rettungswesen in Österreich steht, gibt es aufgrund der historisch unterschiedlichen Ausgangslagen in den Bundesländern nicht. Mitentscheidend wird jedenfalls sein, inwieweit
es gelingt,
- die Finanzierungsschlüssel zwischen Ländern und Gemeinden an die Entwicklung des Rettungswesens der letzten Jahrzehnte anzupassen; der ursprüngliche verfassungsrechtliche Aufgabenbereich des „örtlichen“ Rettungswesens aus dem Jahr 1962 entspricht nicht mehr der heutigen Realität – auch der „einfache“ Rettungs- und Krankentransport stellt längst eine überörtliche Aufgabe dar, die einen deutlich höheren Finanzierungsanteil der Länder erfordert,
- die Rettungs- und Krankentransportsysteme durch die Reduktion nicht notwendiger Fahrten (darunter fallen auch sogenannte „Heimtransporte“) zu entlasten (z. B. durch den Ausbau der Notrufnummer 1450); nach wie vor belasten „Bagatellfahrten“, die vom Rettungsdienst derzeit aus rechtlichen Gründen nicht abgelehnt werden dürfen, das Gesundheitssystem (einschließlich der Spitalsambulanzen) finanziell und personell in hohem Umfang,
- den hohen Anteil an Ehrenamtlichkeit im Rettungs- und Krankentransportdienst in Österreich als historische Stärke zu bewahren, da er einen entscheidenden Schlüssel für den Erhalt des flächendeckenden Rettungswesens in der Zukunft bildet; die proaktive Eröffnung von Qualifikations- und Entwicklungsmöglichkeiten für ehrenamtliche Sanitäterinnen und Sanitäter (auch im Bereich des Notfalldienstes) stellt einen zentralen Motivationsfaktor bei der Gewinnung und dem Verbleib Ehrenamtlicher in den Rettungsorganisationen dar,
- durch eine Reform der bundesgesetzlichen Grundlagen die Entscheidungskompetenz der Sanitäterinnen und Sanitäter im Hinblick auf die Beurteilung der Transportnotwendigkeit zu erhöhen; dazu muss der erforderliche rechtliche (unter anderem Minimalisierung des Haftungsrisikos für das eingesetzte Rettungsdienstpersonal), technische (erweiterte Diagnostik, digitale Übertragung von Gesundheitsdaten) und organisatorische (Qualitätssicherung, z. B. durch Telenotärzte) Rahmen sichergestellt werden.
In einzelnen Bereichen besteht bereits eine durchaus dynamische Entwicklung, während die Reform des SanG seit mehreren Jahren in der Warteschleife hängt. Auch die Neuregelung der Finanzströme ist ein zähes Ringen. Obwohl die Gemeinden die Leistungen „ihrer“ Rettungsorganisationen und vor allem das ehrenamtliche Engagement sehr schätzen, sind immer weniger Gemeinden in der Lage, auf Basis der bestehenden Finanzierungsschlüssel ihren Beitrag zu leisten. Die Zukunft des Rettungswesens in Österreich geht daher deutlich über strukturelle und organisatorische Fragen im Rettungs- und Krankentransportbereich hinaus. Sie kann nur über eine transparente Reform der Finanzströme gesichert werden, die die Leistungsfähigkeit der Gemeinden nicht übersteigt.