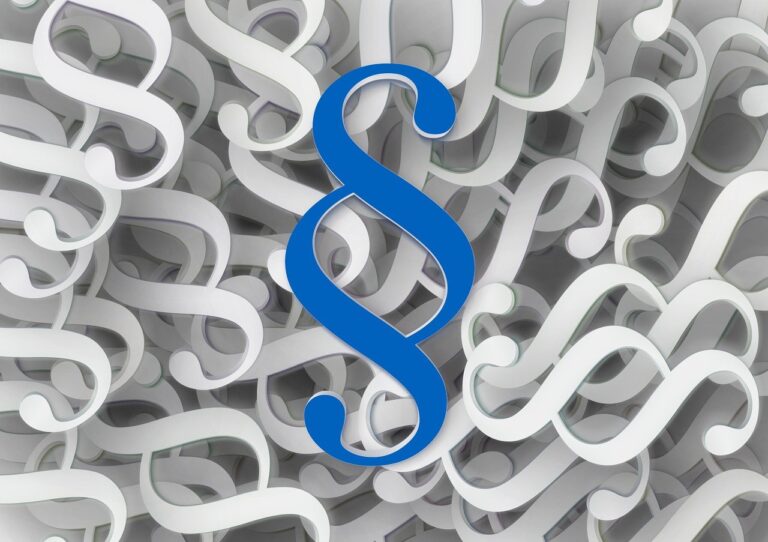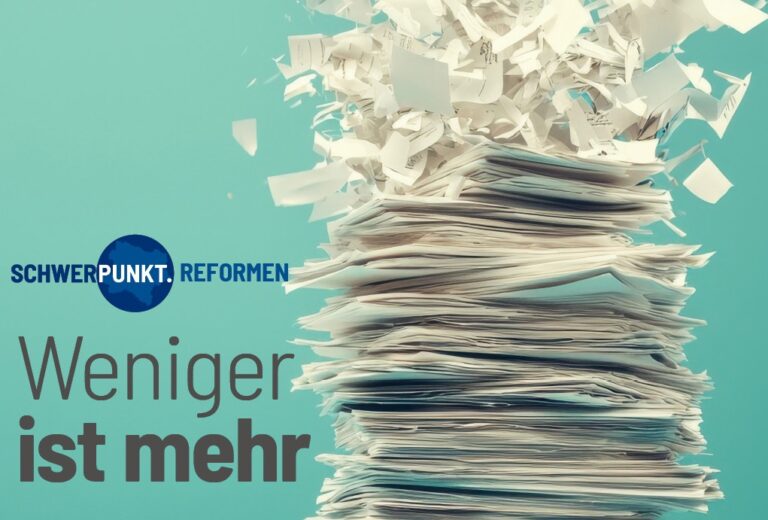Manche bücken sich, manche drücken sich – um die Hundekot-Thematik möglichst in den Griff zu bekommen, gibt es in Niederösterreichs Gemeinden die unterschiedlichsten Präventivmaßnahmen.
Autor: Bernhard Steinböck
Wer mit seinem Hund Gassi geht, kennt die alltägliche Verantwortung: Das „Hundstrümmerl“ gehört in ein Sackerl und dann in den Müll. Doch nicht alle nehmen diese Pflicht ernst. Besonders in urbanen Gebieten wird das Problem oft sichtbarer, während es in ländlichen Regionen teils als weniger relevant empfunden – und dann erst recht liegengelassen wird. Dabei sorgt Hundekot sowohl in Städten als auch in kleineren Gemeinden für Diskussionen. Während große Kommunen mit hohem Fußgängeraufkommen auf strengere Kontrollen und Bewusstseinsbildung setzen, ist das Thema in ländlichen Gegenden meist von der Disziplin der Einzelnen abhängig.
Rechtliche Grundlagen und hohe Strafen
Damit die Hinterlassenschaften der Vierbeiner nicht allzu oft für Ärger und Streit sorgen, werden Strafgebühren eingehoben, wenn Halter den Hundekot nicht wegräumen. Laut § 8 des NÖ Hundehaltegesetzes ist jeder Hundehalter verpflichtet, die Exkremente seines Hundes in öffentlichen Bereichen unverzüglich zu beseitigen. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, dem drohen Strafen von bis zu 7.000 Euro.
Baden: Kein wachsendes Problem, aber immer ein Thema
Laut dem Pressereferat der Stadt Baden ist das Problem des Hundekots „so groß oder klein wie überall“. Beschwerden gibt es zwar weiterhin, allerdings in geringerem Umfang als früher. Die Diskussion hat sich zunehmend auf soziale Medien verlagert. „Statistiken gibt es keine, aber es hat sich sicherlich verbessert“, so die Stadtverwaltung. Vor ein paar Jahren wartete die Stadt mit einer Idee auf, die für große Schlagzeilen sorgte: Hundekot solle per DNA-Test dem Verursacher zuzuordnen sein. Auf Nachfrage meint Oberst Walter Santin von der Stadtpolizei Baden dazu: „Es gibt keine gesetzliche Grundlage für die Abnahme von DNA für Hunde. Eine Stadt alleine könnte das meiner Meinung nach auch nicht beschließen, und wenn wie komme ich dann zur DNA von Hunden aus einer anderen Stadt. Es ist auch fraglich, ob Hundebesitzern Tests überhaupt vorgeschrieben werden könnten. Das ist derzeit kein Thema, und kann es meiner Meinung nach wie gesagt auch nicht mehr werden.“ Die Stadt setzt weiterhin auf Maßnahmen wie Reinigung, Hundesackerl-Spender, Mülleimer, Information und Kontrollen durch die Stadtpolizei.
Wiener Neustadt: Aufklärung statt Strafen
Auch in Wiener Neustadt geht man das Thema mit einem pragmatischen Ansatz an. „Der Ordnungsdienst der Stadt setzt bei Übertretungen nach dem NÖ Hundehaltegesetz („Hundstrümmerl“) auf Ermahnungen und aufklärende Gespräche“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, der anfügt: „So konnten bislang alle Hundehalter, die auf frischer Tat ertappt wurden, dazu gebracht werden,
die Exkremente umgehend wegzuräumen. Anzeigen und Strafen waren zum Glück nicht notwendig.“ Mit den neuen Befugnissen für den Ordnungsdienst könnte sich die Situation noch weiter verbessern, so Schneeberger, der auf den Landtagsbeschluss (Polizeistrafgesetz) von Ende Jänner verweist, der es NÖ Gemeinden nun ermöglicht, Sicherheitsorgane anzustellen, die mehr Kompetenzen haben als bisher.
Mödling: Eine Erfolgsgeschichte mit den Dog Watchern
Die Anzahl der Hunde in Mödling ist in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen, aber auch die Menge an Tages-Ausflügler in Hundebegleitung hat sich deutlich vergrößert. 2014 startete Vizebürgermeisterin Franziska Olischer mit großer, positiver Resonanz das Projekt „Rund um den Hund“ und initiierte gleichzeitig die „Dog- & Wastewatcher“. „Nach unzähligen Veranstaltungen und erfolgreichen Gesprächen mit Mödlinger Bürgern haben wir unser Team auf vier Personen verstärkt. Damals kam dann auch das Thema „Verschmutzung durch Littering“ dazu und wir wurden die „Dog- & Wastewatcher Mödling“. Wir haben auch eine starke soziale Aufgabe: wir sehen uns als Mediatoren zwischen Beschwerdeführern und Verursachern. Viele Menschen rufen uns direkt an und berichten von Problemen mit HundebesitzerInnen“, so Olischer. Durch das bewährte Konfliktmanagement werde auch die Gemeinde entlastet, großer Wert wird auf ein funktionierendes Miteinander gelegt – Strafen und Anzeigen nur als letzte Konsequenz gewählt. Wir legen Wert auf ein positives Miteinander und stellen Strafen und Anzeigen hinten an.
Bisamberg: Ein Balanceakt zwischen Stadt und Land
Bürgermeister Johannes Stuttner beschreibt Bisamberg als „eine Übergangsgemeinde zwischen urban und ländlich“. Neben dem Problem mit Hundekot sorgt hier auch mangelnder Respekt vor fremdem Eigentum für Konflikte. „Die Leute gehen quer über die Felder von Weingärten, was für zusätzliche Spannungen sorgt“, so Stuttner. Trotz kostenloser Hundesackerl-Spender nutzen nicht alle dieses Angebot. „Die Gacki-Sackerln kosten der Gemeinde im Jahr etwa 5.000 Euro. Unsere Gemeindemitarbeiter müssen sich nach dem Mähen oft mehrmals umziehen, weil sie wieder einmal braun gesprenkelt sind.“
Fazit: Hundekot bleibt ein Dauerthema
Ob Großstadt oder Kleingemeinde – der Umgang mit Hundekot bleibt ein fortwährendes Spannungsfeld zwischen Vorschrift, Pragmatismus und Eigenverantwortung. Während manche Orte wie Mödling mit innovativen Ansätzen punkten, setzen andere auf Kontrolle und Prävention. Die rechtlichen Grundlagen sind klar, doch in der Praxis bleibt es eine Frage der Eigenverantwortung der Hundehalter. Und am Ende wäre es doch so einfach, denn ein kleines Plastiksackerl kann große Diskussionen verhindern.