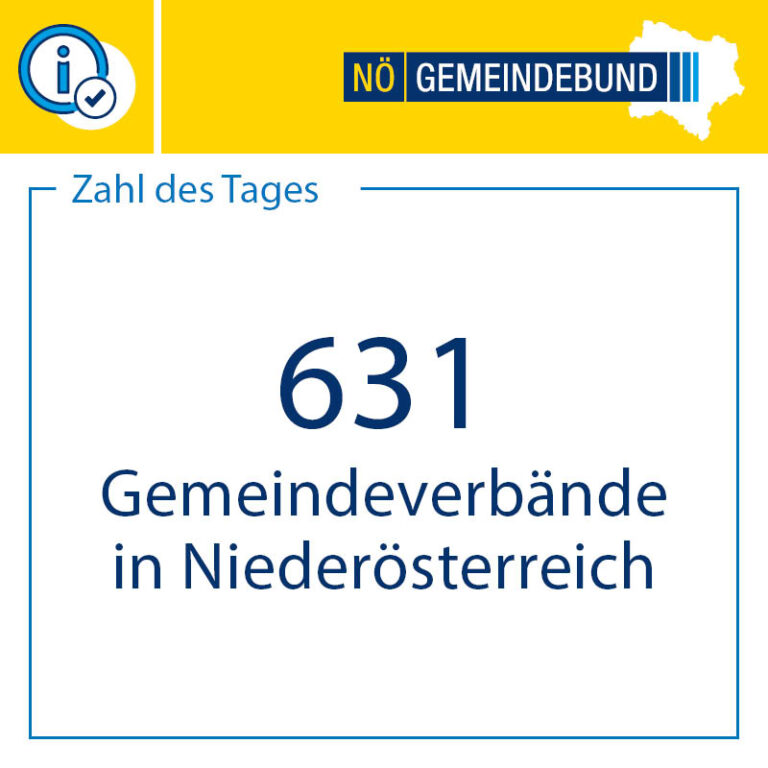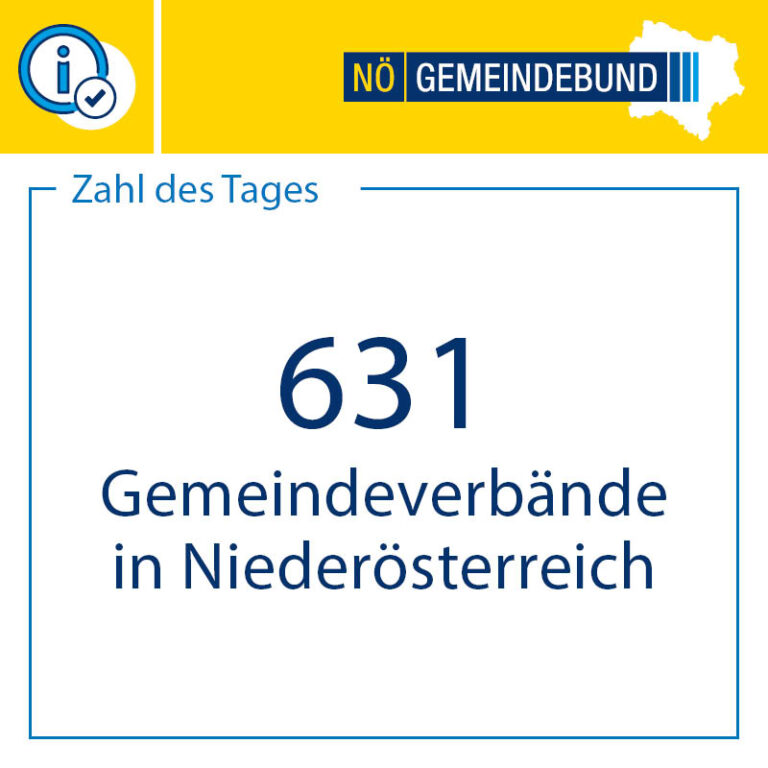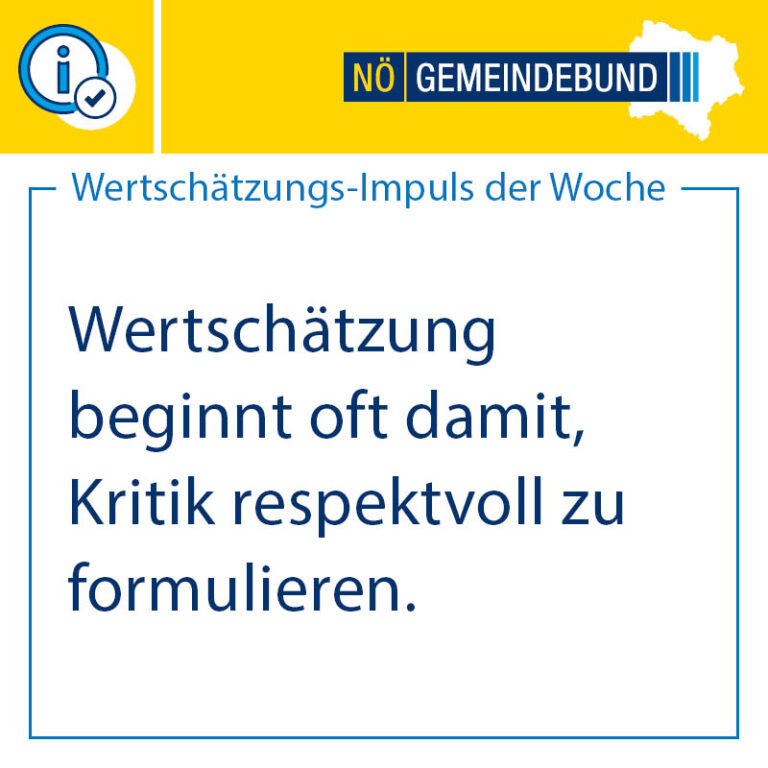Beim Einbau der Vertragsraumordnung in die Raumordnungsgesetze der Bundesländer in den 1990er Jahren ging es vor allem um die Begrenzung der Baulandmenge in den Gemeinden in dem Sinn, dass die zeitnahe Nutzung/Bebauung bzw. die Verfügbarkeit der künftigen Baulandflächen durch sogenannte „Mobilisierungsverträge“ gesichert wurde. Dabei stand der sparsame Umgang mit dem Boden noch nicht so sehr im Vordergrund, sondern neben der Schaffung leistbarer Bauplätze wollte man auch die negativen raumplanerischen und finanziellen Folgen (Verkehrserzeugung, Infrastrukturkosten) der Widmung von Bauland an den Siedlungsrändern eindämmen.
Beitrag von Gerald Kienastberger
In den letzten Jahren ist die Vertragsraumordnung auch als Instrument zur Verbesserung des Bodenschutzes in den Vordergrund getreten, ohne dass es dazu größerer Veränderungen an den Rechtsgrundlagen im NÖ Raumordnungsgesetz 2014 (NÖ ROG) bzw. dessen Zielsetzungen bedurft hätte. Wenngleich der Abschluss eines Mobilisierungsvertrages zwischen der Gemeinde und dem/den von einer beabsichtigten Baulandwidmung betroffenen Grundeigentümer/n die möglichst rasche Bebauung der entstehenden Bauplätze bezweckt, was naturgemäß mit dem Verbrauch des Bodens verbunden ist, bewirkt eine konsequente Vertragsraumordnung dennoch insgesamt die Verringerung der neu gewidmeten Baulandmenge in den Gemeinden.
Kleinflächige Erweiterungen von Mobilisierungsmaßnahmen ausgenommen
Seit der ROG-Novelle 2020 sind die Gemeinden bei der Erstwidmung von Bauland und der Änderung von Widmungsarten des Baulandes verpflichtet, durch Mobilisierungsmaßnahmen die rasche Bebauung der betreffenden Grundstücke mit Hauptgebäuden sicherzustellen (§ 17 Abs.1). Diese grundsätzliche Verpflichtung wurde durch eine weitere Novelle zu Beginn des heurigen Jahres entsprechend den Erfahrungen der Praxis nachjustiert, indem man kleinflächige Erweiterungen wie z. B. bloße Abrundungen von bestehenden Bauplätzen – ohne die Schaffung neuer Bauplätze – von der Festlegung von Mobilisierungsmaßnahmen ausgenommen hat.
Die Gemeinden haben bei der Setzung von Mobilisierungsmaßnahmen die Wahl zwischen dem Abschluss eines Mobilisierungsvertrages und der Befristung der beabsichtigten Baulandwidmung. In beiden Fällen beträgt die Maximalfrist für die Bebauung sieben Jahre, wobei bei der befristeten Widmung eine Verlängerung der Frist um höchstens drei Jahre möglich ist, wenn ein rechtzeitiger Baubeginn ohne „Verschulden“ des Grundeigentümers nicht möglich oder zumutbar war und dies spätestens sechs Monate vor Ablauf der Frist bei der Gemeinde angeregt wird. Damit ist klargestellt, dass auf eine Verlängerung kein Rechtsanspruch besteht. Aus dem Wortlaut des Gesetzes kommt auch eindeutig zum Ausdruck, dass die Gemeinde aus besonderen Gründen eine kürzere Bebauungsfrist vorgeben darf.
Befristete Baulandwidmung sollte nur in Einzelfällen angewendet werden
Grundsätzlich ist zu bemerken, dass Maßnahmen der Raumordnung und somit auch die Inhalte des Flächenwidmungsplanes schon aus verfassungsrechtlichen Gründen (insbesondere des Vertrauensschutzes) auf Dauer angelegt sind und nur aus besonderen, im Gesetz aufgezählten Gründen, abgeändert werden dürfen. Damit steht naturgemäß das Instrument der befristeten Baulandwidmung in einem Spannungsverhältnis und sollte daher nur in wohl begründeten Einzelfällen angewendet werden. Dies kann beispielsweise bei der Widmung von Bauland-Sondergebiet der Fall sein, wenn kurzfristig für ein spezielles Bauvorhaben – oft auch als Einzelobjekt im bisherigen Grünland – die passende Baulandwidmung geschaffen werden soll. Es hat sich nämlich in der Vergangenheit öfters gezeigt, dass im Fall des Scheiterns des beabsichtigten (Groß-)Projekts die extra dafür festgelegte Sondergebietswidmung nur schwer wieder zu entfernen war. Mit der nunmehr im Gesetz geregelten automatischen Rückwidmung bei nicht fristgerechter Bebauung entfällt der Druck auf die Gemeinden, nicht genutztes, befristetes Bauland krampfhaft beizubehalten.
Bodenschutzmaßnahmen als Vertragsinhalt möglich
In der Praxis der letzten Jahrzehnte hat sich die Vertragsraumordnung als das wirksamste Instrument der Baulandmobilisierung herausgestellt.
Dazu kommt, dass im § 17 Abs. 3 und 4 des NÖ ROG die Ermächtigung der Gemeinden zu weiteren Vertragsinhalten ausgebaut bzw. präzisiert wurde, was die Rechtssicherheit für die Gemeinden erhöhte und damit auch die Umsetzung dieser rechtlich anspruchsvollen Materie erleichterte. Dies betrifft vor allem Maßnahmen zur Verbesserung der Baulandqualität und der Siedlungsstruktur. Unter Verweis auf die aktualisierten besonderen Leitziele für die örtliche Raumordnung im § 1 Abs. 2 Z 3 unter besonderer Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels ist es somit zulässig, auch spezielle Maßnahmen zum Schutz des Bodens wie Versiegelungsverbote für Kfz-Abstellplätze, Retentions- bzw. Versickerungsflächen für Niederschlagswässer und dergleichen zum Vertragsinhalt zu machen.
Nutzungsvereinbarungen als Vertragsinhalt
Ein großer Schritt, Maßnahmen des Bodenschutzes über die Vertragsraumordnung umsetzen zu können, war die Ermächtigung der Gemeinden im § 17 Abs. 4 NÖ ROG, Nutzungsvereinbarungen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Baulandqualität auch bei der Festlegung oder Abänderung von Grünland-Widmungsarten oder von Verkehrsflächen zum Vertragsinhalt zu machen. Dies könnte insbesondere bei nutzungsintensiven Grünlandwidmungsarten wie Kleingartenanlagen, Campingplätzen, Lagerplätzen, Sportstätten und dergleichen ein wirksamer Beitrag zum Schutz des Bodens sein.
Gleichzeitig erstreckte der Gesetzgeber diese Möglichkeit auch auf die Erlassung oder Abänderung von Bebauungsplänen. Für ca. die Hälfte der NÖ Gemeinden, welche zumindest Teilbebauungspläne erlassen haben, könnten somit Bodenschutzmaßnahmen nicht erst aus Anlass einer Bauführung über den Baubewilligungsbescheid in Form von Auflagen, sondern bereits aufgrund der vertraglichen Vereinbarung umgesetzt werden.
Abschließend kann man daher feststellen, dass die vielfältigen Möglichkeiten der Vertragsraumordnung auch für den Bodenschutz maßgeschneiderte Instrumente bieten.