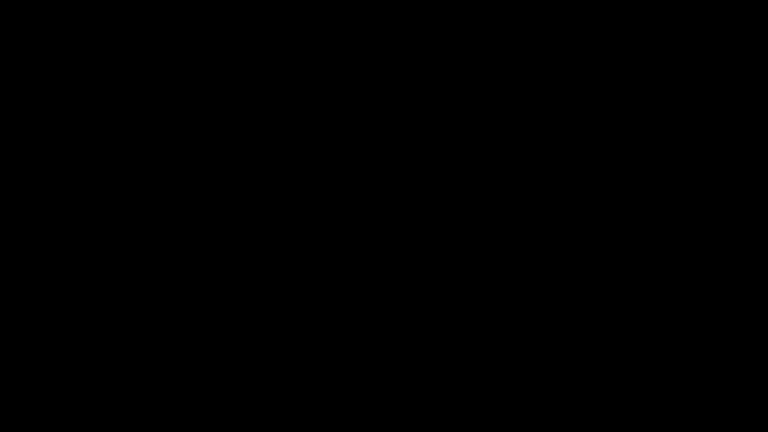Warum nach einem Krankenhausaufenthalt oft Koordination und Kommunikation versagen, wenn es um die Versorgung von Patienten geht. Und was Gemeinden, Angehörige und Hausärzte tun können, um für eine bessere Betreuung und Versorgung zu sorgen.
Autor: Gerhard Sengstschmid
Der letzte Tag im Krankenhaus ist nicht automatisch der erste Tag in einem gut organisierten neuen Alltag. Viel zu oft endet die Akutbehandlung mit einem dicken Entlassungsbrief, aber einem dünnen Sicherheitsnetz. Angehörige stehen vor ungeklärten Fragen, Hausärzte warten auf Informationen, die Gemeinde erfährt, wenn überhaupt, erst über Umwege, dass jemand plötzlich Unterstützung braucht. Das Ergebnis: Verunsicherung, vermeidbare Komplikationen, unnötige Wiedereinweisungen und ein Gefühl, „zwischen den Systemen“ durch den Versorgungsrost zu fallen.
Angehörige zwischen Pflichtgefühl und Überforderung
Denn die Anforderungen an Patienten und Angehörige sind mannigfaltig: Oft müssen die Betroffenen innerhalb weniger Stunden Hilfsmittel organisieren, Medikamente verstehen, Transport klären, Termine für Nachsorge und Therapie vereinbaren, Pflegegeldfragen angehen und die Wohnung an neue Bedürfnisse anpassen. So werden Angehörige – oft ohne Vorwarnung – zu Gesundheitsmanagern, und viele stoßen an organisatorische Grenzen und scheitern an strukturellen Brüchen. In der Klinik zählt vor allem die gelungene medizinische Behandlung und das Entlassungsmanagement hat nur einen bestimmten Handlungsspielraum, der nach der Entlassung endet. Zu Hause beginnt dann für viele ein soziales und organisatorisches Großprojekt, meistens ohne konkreten Plan. „Ich habe die Ärztin kaum verstanden, der Brief war voller Fachausdrücke, und trotzdem hieß es: Morgen geht es heim“, erzählt Anita S., eine Tochter, die ihren Vater nach einer Hüft-OP abgeholt hat. „Auf einmal war ich Pflegerin, Apothekerin und Logistikerin und das alles ohne richtige Einweisung.“
Wo hakt es? Und warum?
Die neuralgischen Punkte wiederholen sich: Arztbriefe erreichen Hausarztpraxen verspätet oder unvollständig, Hilfsmittel sind verordnet, aber nicht geliefert, Therapietermine sind empfohlen, aber nicht gebucht. Und am Wochenende verdichten sich die Probleme, weil wichtige Kontaktstellen geschlossen haben. Hinter diesen Reibungen stehen strukturelle Ursachen: Landesgrenzen und getrennte Finanzierungslogiken, Personalmangel und hoher Zeitdruck, fehlende Standardisierung bei Dokumenten und Kommunikationswegen sowie eine Governance, die regionale Verantwortung für Überleitungen oft nicht klar zuweist. Schuld ist niemand daran, und genau das ist das Problem.
Mögliche Lösungsansätze
Gutes Entlassungsmanagement beginnt nicht an der Ausgangstür, sondern bei der Aufnahme. Sie ist ein Prozess, kein Datum. Die Betroffenen brauchen klare, verständliche Anweisungen: Was passiert morgen? Wer ruft übermorgen an? Welche Warnzeichen erkenne ich? Wer hilft mir, wenn ich nicht weiterweiß? Genau hier kommen Lotsenfunktionen ins Spiel: Community Nursing, Case Management, wie immer man es nennen will. Eine fachlich fundierte Person, die erreichbar bleibt, die Termine sortiert, die Medikationslisten mit der Hausarztpraxis und der Apotheke abstimmt, die weiß, welcher Duschsitz in welcher Größe passt und wie man einen Reha-Antrag korrekt ausfüllt. Wenn dann noch die Kommunikation zwischen Krankenhaus, Hausarztpraxis und mobilen Diensten funktioniert, ist schon viel geschehen.
Gemeinden als Drehscheibe ohne Mandat
Gemeinden erleben die Folgen dieses Übergangs sehr oft unmittelbar. Sie sind meist dann erste Anlaufstelle, wenn etwas schiefgeht, und doch werden sie selten proaktiv eingebunden. Gerade in kleineren Gemeinden erfahren Mandatare oder Gemeindebedienstete meist über den lokalen „Buschfunk“, dass jemand wieder daheim ist und Hilfe braucht. Oftmals bieten dann jene, die sich sowieso schon gesellschaftlich oder sozial engagieren, organisatorische Hilfe an. Denn in vielen niederösterreichischen Gemeinden funktioniert das Miteinander Gott sei Dank noch sehr gut. Vieles lässt sich mit vorhandenen Mitteln verbessern, wenn man Abläufe bündelt und Angebote klar kommuniziert. Eine Gemeinde kann eine zentrale Ansprechstelle etablieren, also eine Telefonnummer, hinter der echte Koordination passiert. Sie kann eine kleine, gut gepflegte Übersicht der regionalen Angebote führen: Wer liefert Hilfsmittel kurzfristig? Welche Praxis hat welche Öffnungszeiten? Welche Therapiestellen nehmen akut neue Patienten? Die Gemeinde kann die erste Woche zu Hause sichtbar machen, etwa in Form einer schlichten Mappe mit To-dos, wichtigen Kontakten, Tipps zur Sturzprävention und Hinweisen zu Befreiungen und Anträgen. Und sie kann regelmäßige Runden mit Hausärzten, mobilen Diensten, Apotheken, Rettung und Krankenhaus abhalten, um Engpässe zu besprechen und die Koordination zu verbessern.
Versorgung ist Teamarbeit. Gemeinden sind der soziale Kitt.
Die NÖ Kliniken arbeiten auf hohem Niveau, die niedergelassene Versorgung ebenso. Was oft fehlt, ist der verbindliche Steg zwischen beiden Ufern und hier haben Gemeinden eine Schlüsselrolle. Sie kennen die Menschen, die Wege, die Angebote. Sie können ordnen, sichtbar machen, zusammenführen. Denn am Ende genügt oft ein Stück Verlässlichkeit, jemand, der sagt: „Du bist nicht allein mit dieser Liste.“ Wenn Entlassung als Prozess gedacht wird, wenn eine Lotsenperson Verantwortung übernimmt, wenn die erste Woche zu Hause strukturiert ist und die Gemeinde früh eingebunden wird, gewinnen alle: Patienten an Sicherheit, Angehörige an Luft, Gemeinden an Planbarkeit und das Gesundheitswesen an Effizienz und Menschlichkeit. Oder, wie es Anita S. formuliert: „Es braucht nicht mehr Helden. Es braucht bessere Übergänge.“
INFO
Entlassungsmanagement der NÖ Kliniken
Laut Landesgesundheitsagentur ist ein Entlassungsmanagement in jedem NÖ Klinikum etabliert und wird schon immer durchgeführt. Das Team des Entlassungsmanagements setzt sich aus vielen verschiedenen Berufsgruppen (Krankenpfleger, Sozialarbeiter …) und Personen verschiedener Abteilungen zusammen.
Die Hauptaufgaben des Entlassungsmanagements:
- Sicherstellen einer kontinuierlichen Betreuung nach einem erfolgten Transfer (z. B. rechtzeitige Organisation von Medikamenten, Heilbehelfen und Hilfsmitteln).
- Gewährleisten eines nahtstellenübergreifenden Informationsflusses.
- Klare und effiziente Gestaltung der Dokumentations- und Informationsflüsse.
- Entlastung der Betreuungs- und Vertrauenspersonen.
- Stärken der Eigenverantwortung der Patienten.
Die größten Herausforderungen des Entlassungsmanagements sind die zunehmende Überalterung der Bevölkerung, die Zunahme demenziell erkrankter Menschen und gesellschaftliche Veränderungen wie das Fehlen von Angehörigen, das soziale Umfeld oder Singlehaushalte.