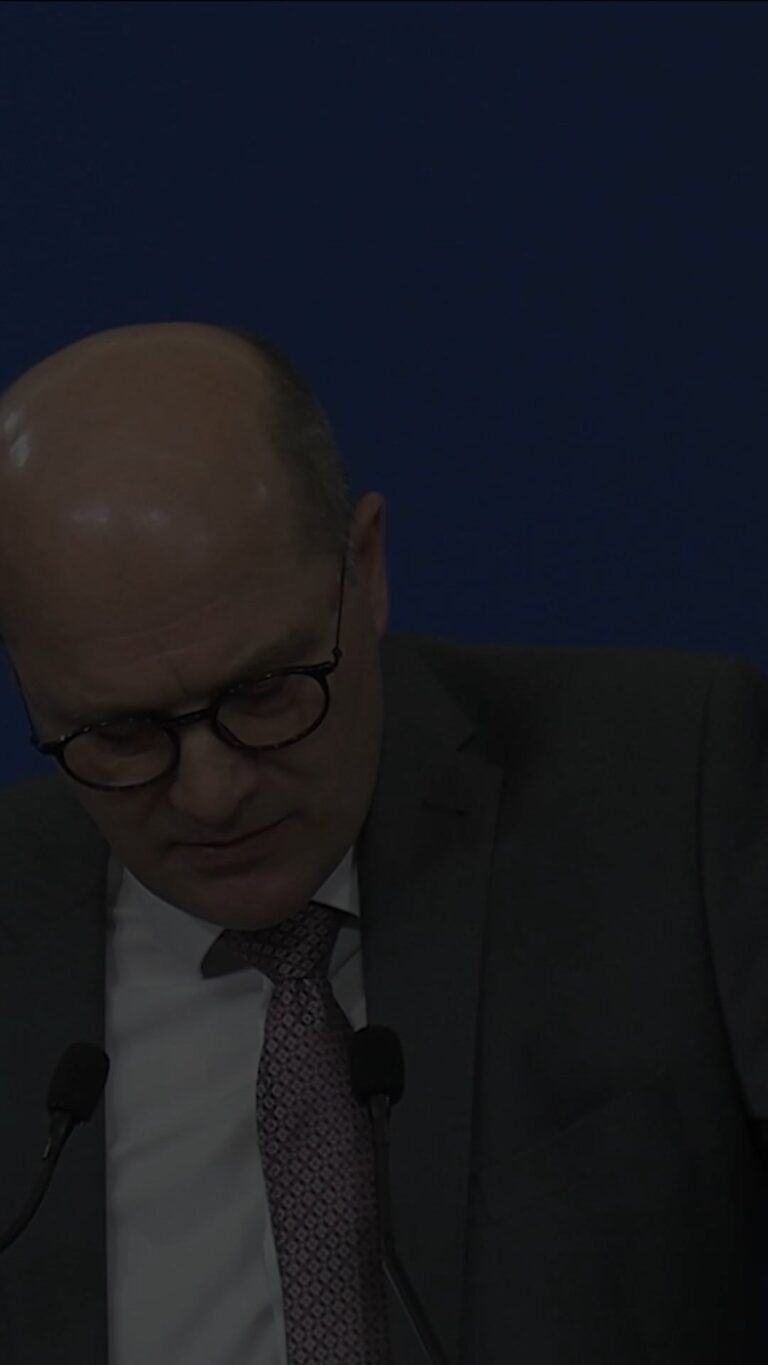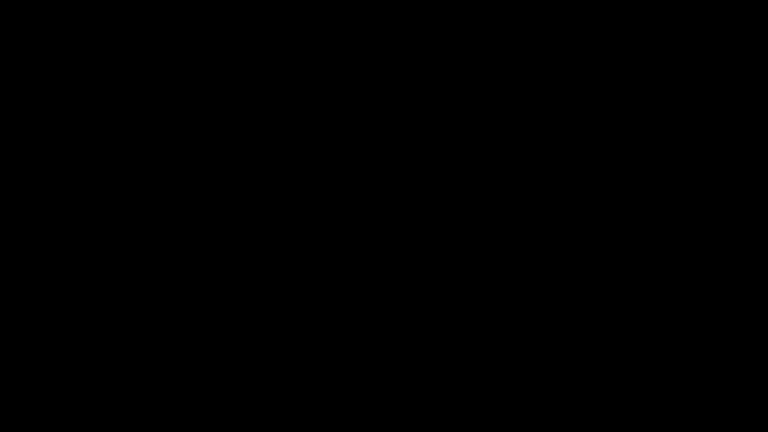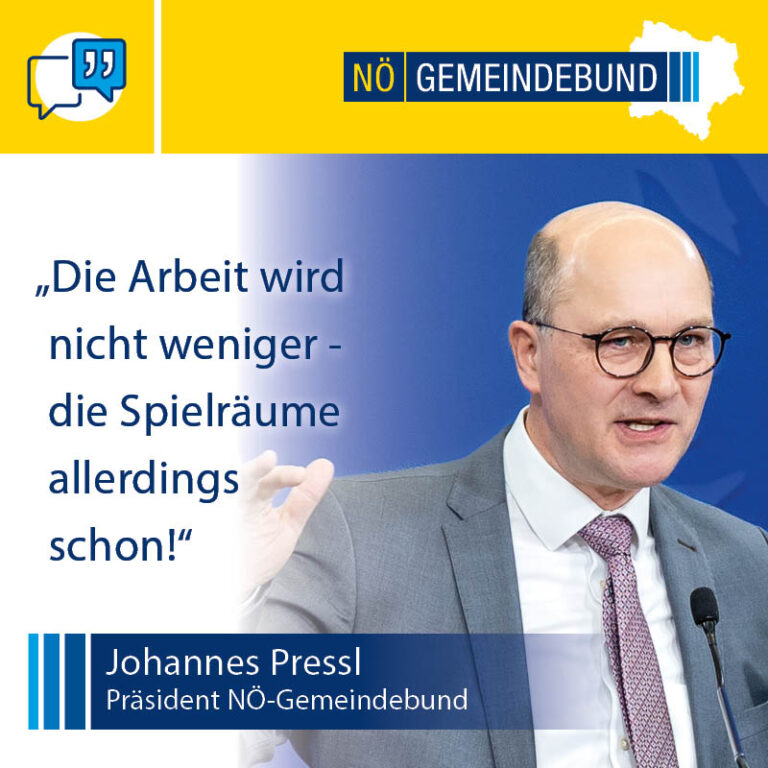… braucht viele auf die Situation angepasste Unterstützungsbausteine. Eine klare Strategie der Gemeinden ist erforderlich.
Autor: Johannes Pressl
Die Lebenserwartung der Bevölkerung steigt – zum Glück! Damit verbunden aber auch die Anzahl jener, die eine Form der Unterstützung im Alltag brauchen – bis hin zur Pflege im Heim als „höchste“ Unterstützungsleistung. Während die Pflegeheime und auch die Hauskrankenpflege in Niederösterreich klar geregelt sind, sind es die „Vorstufen“ vor einer intensiveren Pflege nicht. Nachdem die Menschen allerdings allen Umfragen zufolge im Alter so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause oder in der vertrauten Nachbarschaft wohnen wollen, kommt das Thema unausweichlich mit dem Anstieg der Anzahl der Älteren in einer Gemeinde automatisch auf diese zu. Das Bild der „Pflegekaskade“ – von einfachen Alltagshilfen bis zur stationären Versorgung – soll helfen, darauf gut vorbereitet zu sein. Idealerweise soll sich daraus eine „Strategie“, vielleicht auch ein Zielbild entwickeln, wie jede einzelne Gemeinde auf diese Entwicklung reagieren will.
Wir leben immer länger. Parallel dazu steigt der Pflege- und Betreuungsbedarf enorm.
Frauen können bis zum Jahr 2080 mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 92 Jahren rechnen, um fast acht Jahre mehr als heute. Männer werden sogar um fast zehn Jahre älter werden als heute und im Durchschnitt 89,4 Jahre erreichen. Gute medizinische Versorgung, weiter steigender Wohlstand, aber auch eine immer sicherere Arbeits- und Lebenswelt sind die Treiber dahinter. Wer allerdings meint, dass die Gesundheit und Fitness gleichermaßen „mitsteigen“, der irrt gewaltig: Zahlen aus Deutschland zeigen, dass bei über 80-Jährigen 50 Prozent einen Pflegebedarf haben und dieser bei über 90-Jährigen auf 80 Prozent ansteigt. Multimorbidität, dementielle Erkrankungen oder auch Bewegungseinschränkungen sind Ursachen dafür. Prognosen zufolge könnte österreichweit die Zahl der durch professionelle Pflegedienste betreuten Personen bis 2050 auf rund 515.000 Menschen ansteigen.
Gemeindebeiträge zur Pflegefinanzierung und für Projekte zu mehr Altersgerechtigkeit steigen.
Pflege ist bereits jetzt einer jener Posten in den Gemeindebudgets, bei denen es die größten Ausgabensteigerungen gibt. Die Nettoausgaben im Sozial- und Pflegebereich stiegen in den vergangenen zehn Jahren deutlich über den Zuwächsen der Gemeinde-Ertragsanteile. Und bisher unter den Tisch gefallen sind Leistungen der Gemeinden für örtliche Unterstützungsprojekte, wie Essen auf Rädern, Seniorentreffs, Community Nurses, Barrierefreimachung von öffentlichen Räumen oder auch persönliche Hilfeleistungen am Gemeindeamt bei Antragstellungen. Schließlich fallen
auch die Finanzierung von Mobilitätsprojekten und Rufbussen oder begleitende Kosten bei betreuten Wohnformen bei den Gemeinden an. Und gerade auch diese Projektkosten werden weiter enorm steigen, weil in vielen Orten die Infrastruktur noch nicht altersgerecht um- und nachgebaut worden ist. Exkurs zur bundespolitischen Reformpartnerschaftsdiskussion: Einen Rückzug aus der Pflegeorganisation und Pflegefinanzierung wird es seitens der Gemeinden nicht geben. Denn wie bei der Kinderbetreuung machen wir all das am besten dort, wo es den Menschen am nächsten ist – und das ist auch die Vorsorge, das sind alle Vorstufen zur Pflege und die Pflege selbst – in den Gemeinden und gemeindenahen Einrichtungen.
Die „Pflegekaskade“ soll Angebot und Mitteleinsatz optimieren.
Nicht alle Menschen benötigen sofort weitreichende Hilfe und intensive Pflege. Vielfach genügen zunächst einfache Unterstützungen: Ein Zugang zu Mobilität, beispielsweise durch einen Rufbus, kann bereits entscheidend sein, um älteren Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Erst in einem nächsten Schritt – falls beispielsweise im Haus niemand kocht – könnten Dienste wie Essen auf Rädern oder mobile Betreuung folgen, die es Menschen ermöglichen, weiterhin in den eigenen vier Wänden zu leben. Eine 24-Stunden-Pflege oder ein Heimplatz kommen erst viel später in dieser „Pflegekaskade“ zum Tragen und werden auch von deutlich weniger Menschen genutzt werden müssen als die Vorgenannten. „Pflegekaskade“ bedeutet eine abgestufte Vorgangsweise, bei der immer das mildeste, oft auch das kosteneffizienteste Mittel zum Einsatz kommt – wenn andere Unterstützungsformen nicht mehr ausreichen, aber nicht gleich die höchstwertigste und damit auch teuerste Betreuungsform zugeordnet wird. Allerdings muss auch das Angebot für niederschwellige Pflege-, Betreuungs- oder gemeinschaftliche Versorgungsformen einerseits geschaffen und andererseits transparent denjenigen, die einen Bedarf haben, zur Verfügung stehen.
Für die Einzelgemeinde liegt in der Pflegekaskade auch die Chance, ihre Angebote strategisch und bedarfsgerecht auszubauen. Gemeinsam für ganz Niederösterreich ergäbe sich die Chance, selbst bei individueller Umsetzung in der Einzelgemeinde ein homogenes, über das ganze Land für die Menschen mit Pflegebedarf vereinheitlichtes und qualitativ sehr gutes Angebot anzubieten.
Insofern ist diese abgestufte Herangehensweise nicht nur menschlicher, sondern auch wirtschaftlich sinnvoller. Denn das Ziel muss sein, einerseits mehr Gerechtigkeit zwischen den verschiedenen Pflegeformen zu schaffen, andererseits auch die passende Pflegeform bedarfsgerecht zu den Menschen zu bringen und drittens auch strategisch und passgenau der Demografie folgend am Angebotsausbau zu arbeiten. Schließlich würde eine Pflegekaskade diesen Zuschnitts auch eine ausgewogene und gerechte Förderung aller Stufen ermöglichen, sodass nicht nur ein guter Lenkungseffekt damit verbunden ist, sondern letztlich den Menschen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben zu Hause oder in ihrem Heimatort ermöglicht wird.
Gemeindekooperationen – auch hier ein Mittel zum Zweck
Nicht jede Gemeinde muss und kann – selbst bei einer ausgeklügelten Pflegekaskade – alle Pflegeangebote selbst bereitstellen. Doch jede Gemeinde sollte sich Gedanken machen, wie Menschen Zugang zu jeder Art der Hilfestellung erhalten können. Hier – wie auch in vielen anderen Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge – bieten sich Gemeindekooperationen als ressourcensparende Lösung an. Durch die Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden lassen sich Angebote effizienter gestalten und Kosten senken. Ein gemeinsam organisierter Rufbusdienst, koordinierte mobile Betreuungsdienste oder gemeinsame Beratungsstellen können Synergien schaffen. Kleinere Gemeinden erhalten so Zugang zu Angeboten, die sie allein nicht finanzieren könnten. Größere Gemeinden können ihre Infrastruktur besser auslasten.
Ehrlichkeit gegenüber den Menschen
Die demografische Entwicklung erfordert ehrliche Gespräche über die Finanzierbarkeit der Pflege. Die Gemeinden sind auf verlässliche Rahmenbedingungen von Bund und Ländern angewiesen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Einmalige Hilfspakete reichen nicht aus – notwendig sind strukturelle Reformen, die den Gemeinden nachhaltige Handlungsspielräume eröffnen.
Gleichzeitig zeigt die Pflegepersonalbedarfsprognose, dass bis 2030 rund 51.000 zusätzliche Pflege- und Betreuungskräfte benötigt werden, bis 2050 sogar fast 200.000. Der Fachkräftemangel
in der Pflege verschärft die Situation zusätzlich. In China – hat mir kürzlich der dort vier Jahre lang tätige österreichische Botschafter erzählt – forscht man genau aus diesem Grund intensiv an Pflegerobotern. Heute für uns noch undenkbar, aber angesichts der demografischen und personellen Entwicklung ist das auch mitzudenken.
Finanzielle Rahmenbedingungen müssen stimmen
Die Pflege älterer Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Solidarität zwischen den Generationen erfordert. Die Gemeinden stehen dabei an vorderster Front – sie kennen die Bedürfnisse ihrer Bewohnerinnen und Bewohner am besten. Doch sie können diese Aufgabe nur bewältigen, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen und wenn zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ehrlich über Kosten, Verantwortlichkeiten und Lösungen gesprochen wird. Aus den Reformpartnerschaftsdiskussionen auf Bundesebene ist das Thema zwar ausgeklammert. Die demografische Entwicklung darf trotzdem keine Überraschung sein – die Zahlen sind seit Jahren bekannt und deswegen drängen wir darauf, auch hier die notwendigen
Weichenstellungen vorzunehmen. Unser Ziel: Dass die Gemeinden auch in Zukunft eine qualitätsvolle Pflege für alle Bürgerinnen und Bürger sicherstellen können.